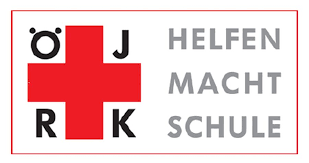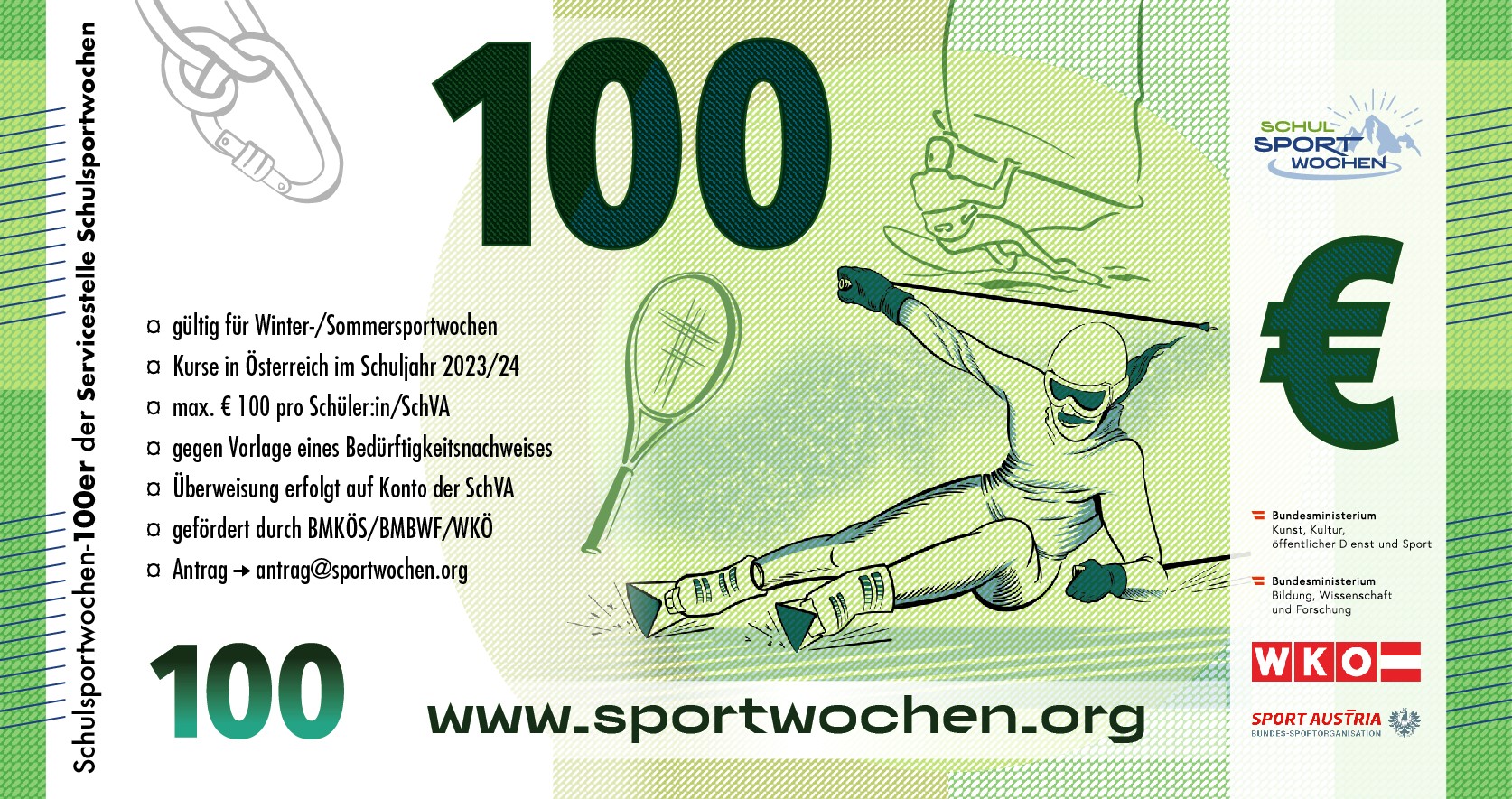Grundkompetenzen absichern
„Mit dem Projekt „Grundkompetenzen absichern“ -Zeitraum 2017-2022 mit über 400 Projektschulen legte das „Unterrichtsministerium“ (bmbwf) einen Fokus auf jene Schulen, die bei den Bildungsstandard-Überprüfungen unter dem Österreich-Schnitt und unter ihrem Erwartungsbereich („fairer Vergleich“) lagen und die daher einen hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern hatten, welche die Grundkompetenzen in Deutsch (Lesen und Schreiben), Mathematik (vierte und achte Schulstufe) und Englisch (achte Schulstufe) nicht erreichten.
Schulen – im Projekt waren das ausschließlich Volksschulen und Mittelschulen – sollten dabei unterstützt werden, die Stärken und Schwächen der Kinder so früh wie möglich zu erkennen und im Rahmen der Individualisierung und differenzierten Förderung zu berücksichtigen.“ (aus: Schlussbericht zur Begleitevaluation, Nov. 2022, Seite 2)
Im Schlussbericht zur Begleitevaluation, Seite 57ff, wurden als zentrale Problembereiche unterdurchschnittliche Schülerleistungen wurden von allen Seiten (Steuergruppen, PH-Projektkoordinator*innen, MPT= multiprofessionelle Teams) angeführt:
die mangelnde Schulleitungskompetenz,
unzureichende Schul- und Teamkultur,
unzureichende Unterrichtsqualität sowie
didaktisch-methodische Kompetenzen der Lehrpersonen und
die Externalisierung der Gründe
Als Gelingensbedingungen wurden folglich genannt:
der Einsatz kompetenter Führungskräfte mit einem klaren Rollenverständnis,
wirkungsvolle Entwicklungsbegleitungsprozesse,
kompetente Beratung und Begleitung durch MPT in erforderlicher Anzahl sowie
hohe Unterrichtsqualität und
kompetente Lehrende
Die am 4. Dezember 2024 veröffentlichten Ergebnisse der TIMMS-Studie sind nur bedingt ein Grund zum Jubeln. Auch wenn Österreich über dem internationalen und dem EU-Schnitt liegt, so darf nicht vernachlässigt werden, dass offenbar ein nicht unerheblicher Teil der guten Leistungen, die den Durchschnitt gehoben haben, auf den Einsatz von Eltern zurückgeht. Das heißt, v.a. jene Kinder, die wegen der Unterstützung durch ihre Eltern oder sonstiger Gründe, gut in der Schule sind, können von Wochenplänen, etc. profitieren, während die anderen nur wertvolle Zeit der direkten Zuwendung durch die Lehrpersonen verlieren.
Überforderung: Selbsttätiges Lernen, oft schon von der 1. Klasse Volksschule an:
Die Schülerinnen und Schüler erhalten vorgegebene schriftliche Aufträge (oft Wochenpläne genannt), die innerhalb einer ebenfalls vorgegebenen Frist zu erledigen sind. Die Lernprozesse, die dabei stattfinden, betreffen in aller Regel Einübungsprozesse und selten das selbständige Erschließen neuer Themen. Selbst organisieren müssen die Lernenden einerseits, wie sie ihre Arbeitszeit einteilen. Wer mehr Zeit braucht, als vorgesehen ist, oder diese nicht von Anfang an produktiv nutzt, muss das Fehlende zuhause nachholen.
Andererseits müssen die Schülerinnen und Schüler insofern Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen, als sie sich konsequent selbst aktiv um Unterstützung bemühen müssen, wenn sie diese brauchen. Die Lehrpersonen gehen oft nicht von sich aus auf die Schülerinnen und Schüler zu, um deren Lernfortschritt zu überprüfen, sondern werden nur aktiv, wenn jemand sie um Unterstützung bittet.
Siehe: Naive Annahmen
- Details
- Kategorie: Elternbrief Mai 2025