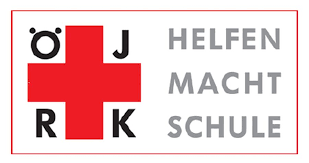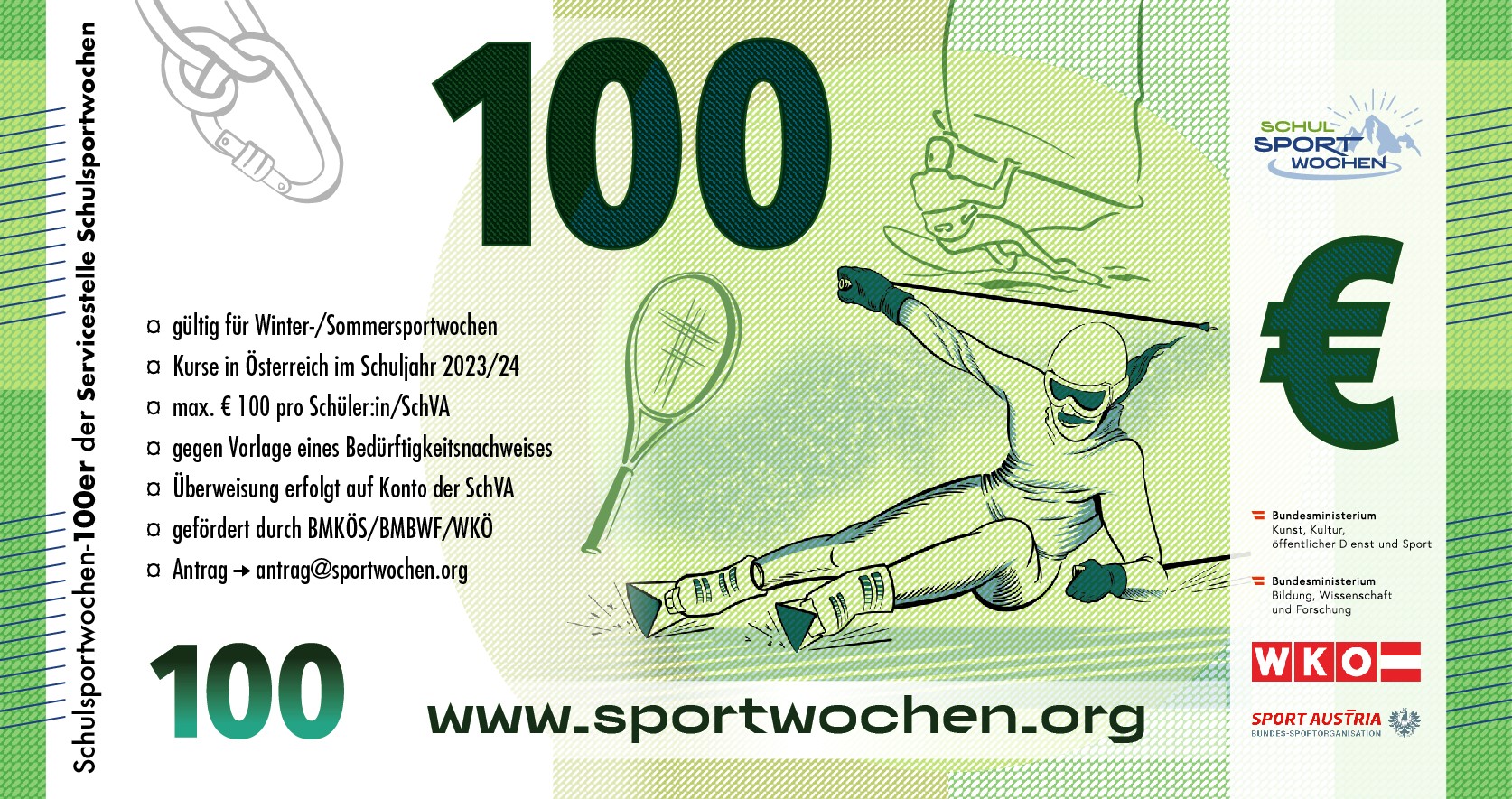Richtlinien für den schulischen Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten beim Rechnenlernen
Schülerinnen und Schüler gelten als rechenschwach, wenn sie trotz adäquater Förderung und angemessenen Bemühens über einen längeren Zeitraum in ihrem Denken mangelhafte Vorstellungen, fehlerhafte Denkweisen und dadurch ungeeignete Lösungsmuster für die mathematischen Grundlagen wie z. B. Zahlenaufbau und Grundrechenarten entwickeln.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass jegliches Einüben und Festigen von Rechenverfahren immer auf Basis von Verständnis erfolgt. Verbalisierung und Vergleich von selbst gefundenen Ergebnissen sind die dafür nötigen Voraussetzungen. Es empfiehlt sich, eine sorgfältige Auswahl der im Unterricht verwendeten Bücher zu treffen.
Grundsätze einer Förderung
Grundlegendes Wissen und Problemverständnis der LehrerInnen für rechenschwache SchülerInnen sind eine wichtige Ausgangsbasis für eine zielführende Hilfestellung. Neben geeigneter Literatur (Broschüre „Die schulische Behandlung der Rechenschwäche“, BMB 2017 www.schulpsychologie.at/lernen-leistung/rechenschwaeche und spezifischen Fortbildungen (z. B. durch pädagogische Hochschulen) stehen insbesondere auch die Beratungseinrichtungen im Bereich der Inklusions- und Sonderpädagogik (ZIS, PBZ) sowie die Schulpsychologie-Bildungsberatung als Ansprechpartner zur Verfügung.
Um eine maßgeschneiderte Förderung anzubieten, ist ein Perspektivenwechsel notwendig, nämlich den Blick weg vom Ergebnis hin zur Beobachtung des Rechenprozesses zu lenken. Rechenfehler sollen als produktiver Problemlösungsversuch des Schülers bzw. der Schülerin und als Fenster in die persönliche Denkwelt angesehen werden. Die Beobachtung und Verbalisierung der vom Schüler/von der Schülerin eingesetzten Rechenwege und Lösungsstrategien sowie die Analyse von Rechenfehlern ermöglichen es, die individuellen Lernvoraussetzungen festzustellen und eine passgenaue Förderung zu gewährleisten.
Eine ermunternde, geduldige und positiv stärkende Grundhaltung der Lehrperson kann die emotionale Situation des Schülers/der Schülerin unterstützen. Situationen, die eine psychische Belastung darstellen können (z. B. Prüfungen, Rechnen an der Tafel, Rechenspiele mit Wettbewerbscharakter) sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren bzw. – wenn möglich – gänzlich zu vermeiden.
Dem Schüler/der Schülerin ist im Unterricht ausreichend Zeit zur Bearbeitung von Rechenaufgaben einzuräumen – bei Bedarf sind entsprechende Aufgabenstellungen oder Arbeitsblätter in der Schule und als Hausübung im Umfang zu kürzen.
Das temporäre Zulassen von unterstützenden Materialien und Methoden zum Aufbau eines entsprechenden Verständnisses ist sinnvoll.
Bei Sach- und Textaufgaben können spezielle Bearbeitungshilfen angeboten werden (Text vorlesen, Besprechen und Erklären von Begriffen und Zusammenhängen, Darstellen mit Material, grafische Bearbeitungshilfen).
Rundschreiben Nr. 27/2017 (BMB) >> hier
NEU Sep. 2025:
Regelung von ausgleichenden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen aufgrund von körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen sowie Sinnesbeeinträchtigungen >> hier
Jugendwegweiser - Jugendliche mit Behinderung
Drei neue Unterseiten und eine aktualisierte Startseiten-Kachel widmen sich seit Kurzem auf der Jugendwegweiser-Website gezielt dem Thema „Jugendliche mit Behinderung".
In den neuen Bereichen finden sich:
Infos zu Leistungen, rechtlichen Grundlagen & Anlaufstellen
Infos & Tipps für Lehrkräfte
Freizeit-, Kreativ- & Mentoring-Angebote zur Förderung sozialer Kompetenzen und persönlicher Entwicklung
https://www.jugendwegweiser.at/servicestellen/fuer-jugendliche-mit-behinderung/
https://www.jugendwegweiser.at/infos-fuer-schulen/jugendliche-mit-besonderen-beduerfnissen/
https://www.jugendwegweiser.at/zusatzangebote/behinderung/
Berufsorientierung, Berufswahltest & Bildung in der Steiermark
Die neue Plattform WasWerden schafft Überblick. www.waswerden.info
Wer was werden will, muss sich erst mal zurechtfinden.
Dafür bietet die Plattform zahlreiche Möglichkeiten: www.waswerden.info
Beratungs- und Orientierungsangebote
Berufswahl- und Interessenstests
Webinare und Infos für Eltern
Persönliche Beratung & Trainings in der Steiermark
Angebote für Vorträge & Workshops
Wichtige Infos für Eltern & Bezugspersonen >> Anlaufstellen für Eltern
FAQs zu Schule, Lehre, Bewerbung & Wiedereinstieg
Ausbildung & Karriere in den sieben steirischen Regionen
 Handbuch für Schulen, BMBWF 2024: Autismus-Spektrum
Handbuch für Schulen, BMBWF 2024: Autismus-Spektrum
Seite 5ff
Dem Ziel der uneingeschränkten Partizipation von Kindern und Jugendlichen im AS im Bildungsbereich und in der Gesellschaft folgend, ist es erforderlich, potenziellen Bildungsrisiken präventiv entgegenzuwirken und durch förderliche pädagogische Gestaltung der Umweltbedingungen, maximale Potenzialentfaltung zu ermöglichen.
Dies gelingt dann besonders gut, wenn alle im Umfeld der Schülerin/des Schülers im AS relevanten Personen zusammenarbeiten und pädagogische Interventionen bestmöglich auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im AS abgestimmt werden.
Dies setzt u. a. auch voraus, dass Eltern/Erziehungsberechtigte, Pädagoginnen/Pädagogen, Therapeutinnen/Therapeuten, etc. in Bezug auf gemeinsame Zielvorstellungen in wertschätzendem kommunikativem Austausch stehen und sich ihrer jeweiligen Rolle bzw. Expertise entsprechend im Sinne von Schülerinnen und Schülern im AS optimal einbringen.
Entwicklungsvoraussetzungen und daraus resultierenden institutionellen Anforderungen kann dadurch gemeinsam konstruktiv, d. h. förderlich im Sinne des Erziehungs- und Bildungsauftrages, entsprochen werden.
Gut zu wissen
Das Handbuch ist so verfasst, dass sich Leserinnen und Leser unabhängig vom ganzen Text anlassbezogen jenen Kapiteln widmen können, denen sie
situationsgebunden die größte pädagogische Priorität zuschreiben.
Dies ermöglicht es, auch bei knappen Zeitressourcen, spezifische Einblicke in thematische Schwerpunkte zu erlangen.
Leitfaden der Autistenhilfe
Der Leitfaden richtet sich an Lehrpersonen aller Schulstufen, die im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit Umgang mit SuS im Autismus-Spektrum haben.
Ziele des Leitfadens sind:
Die Sensibilisierung für die Bedürfnisse dieser SuS im Autismus-Spektrum bei der Bewältigung alltäglicher Hürden
Maßnahmen zur gezielten Unterstützung im schulischen Alltag (mit und ohne Fachassistenz)
Maßnahmen zur gezielten Unterstützung in Bezug auf schriftliche und mündliche Prüfungssituationen (mit und ohne Assistenz) - Gezielte Fördermöglichkeiten
Siehe auch Elternbrief September 2024: SuS im Autismusspektrum
Orientierungshilfe im Umgang mit Schüler/inne/n mit autistischen Verhaltensweisen Schwerpunkt Asperger-Syndrom
Für eine gelungene Förderung eines Kindes mit autistischen Verhaltensweisen in der Schule bedarf es einer guten Vorbereitung und Kooperation zwischen allen Beteiligten.
In diesem Sinn richtet sich dieser Leitfaden an Schulleiter/innen, Lehrpersonen und auch an Eltern. Diese Orientierungshilfe setzt sich zum Ziel, sie dabei zu unterstützen, diese Kinder in unseren Schulen zu integrieren und zu begleiten.
 Orientierungshilfe BD-Tirol
Orientierungshilfe BD-Tirol
Punkt 2, Seite 4: "Wenn die Lehrperson diese unterschiedliche Wahrnehmung der Welt dieser Kinder nicht nachvollziehen kann, entstehen leicht Missverständnisse und damit negative Deutungen.
Zudem sind Lehrer/innen gewöhnt, Arbeitsaufträge und Anweisungen an die gesamte Klasse zu adressieren. Nachdem sich Kinder mit A-S-S mit "alle" nicht angesprochen fühlen, kann die fehlende Kooperation oder Beteiligung leicht als Verweigerung interpretiert werden."
NEU Sep. 2025:
Regelung von ausgleichenden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen aufgrund von körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen sowie Sinnesbeeinträchtigungen >> hier
Artikel 5 der Erklärung der Rechte des Kindes lautet:
„Das Kind, das körperlich, geistig oder sozial behindert ist, erhält die besondere Behandlung, Erziehung und Fürsorge, die seine besondere Lage erfordert.
§ 8 Schulpglichtgesetz eröffnet den Eltern eine Wahlmöglichkeit:
Besuch einer Volksschule, Mittelschule, Polytechnische Schule, Unterstufe einer allgemein bildenden höheren Schule oder einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe, oder einer für sie geeigneten Sonderschule oder Sonderschulklasse
Qualitätsstandards im inklusiven Unterricht von Schüler/innen mit Behinderung
Richtlinien für die Umsetzung und das Monitoring  RS 17 / 2015
RS 17 / 2015  Richtlinien
Richtlinien
Die positive quantitative Entwicklung muss zum Wohl aller Schüler/innen durch nachhaltiges Qualitätsmanagement auf der Ebene der Klasse, der Schule und der Region durch die Einhaltung von verbindlichen Qualitätsstandards gesichert und überprüfbar gemacht werden können.
Es soll erreicht werden, dass
Schule und Unterricht so gestaltet werden sollen, dass Schüler/innen mit Behinderung bzw. mit sonderpädagogischem Förderbedarf:
(a) ein größtmögliches Ausmaß an Förderung zur Entwicklung ihrer individuellen Fähigkeiten und Voraussetzungen erfahren, und
(b) ein Maximum an Integrationschancen in die soziale Umwelt und in die Gesellschaft erhalten.
Eine qualifizierte sonderpädagogische Förderung soll dadurch gewährleistet werden, dass
(a) eine Lehrerin bzw. ein Lehrer mit Spezialisierung in Sonder- und/oder inklusiver Pädagogik mit einem für die Situation notwendigen Ausmaß an Unterrichtsstunden unterrichtet.
(b) allenfalls zusätzlich eingesetzte Lehrerinnen und Lehrer (z. B. in Unterrichtsstunden, in denen keine Lehrerinnen bzw. Lehrer mit Spezialisierung in Sonder- und/oder Inklusiver Pädagogik zur Verfügung stehen) sollen über eine adäquate Zusatzausbildung und/oder die Bereitschaft zur begleitenden Fortbildung verfügen.
Die zugewiesenen sonderpädagogischen Ressourcen sollten angemessen auf die Wochentage aufgeteilt und nicht komprimiert an einigen wenigen Tagen eingesetzt werden.
Individuelle Förderpläne
RS 6 /2009 Richtlinien für die Anwendung von Individuellen Förderplänen als Instrument der Unterrichtsplanung, Evaluierung und Qualitätssicherung im Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Die Arbeit mit individuellen Förderplänen ist im Bereich der Sonderpädagogik auf Bundesebene seit 1996 im Lehrplan der Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder verankert und wurde nunmehr auch mit den neuen Lehrplänen der Allgemeinen Sonderschule, der Sonderschule für blinde Kinder und der Sonderschule für gehörlose Kinder verordnet. Dies bedeutet, dass sowohl in Sonderschulen als auch in Integrationsklassen Individuelle Förderpläne im Unterricht von Schülerinnen und Schülern, die nach einem der genannten Lehrpläne unterrichtet werden, anzuwenden sind.
Bundesweit einheitlicher Rahmen >>  RICHTLINIEN
RICHTLINIEN
Entwicklung und Überprüfung des Individuellen Förderplans
Die erstmalige Erstellung eines Individuellen Förderplans wird in der Regel nach einer vierbis sechswöchigen Beobachtungsphase erfolgen.
Er wird auf der Grundlage einer umfassenden Förderdiagnose (Analyse der persönlichen sowie der umfeldbezogenen Bedingungen) ausgearbeitet und enthält:
· eine präzise Beschreibung des pädagogischen Ist-Zustandes,
· eine Definition der angestrebten Förderziele,
· eine Beschreibung der geplanten Fördermaßnahmen und Methoden,
· die Angabe des geplanten Zeitraumes zur Erreichung der Förderziele,
· Prozessbeobachtungen,
· die Überprüfung der erreichten Ziele und der durchgeführten Maßnahmen sowie
· deren allfällige Adaptierung und die Festlegung der nächsten Ziele und Maßnahmen.
Festgelegte Förderziele und Maßnahmen beziehen sich auf einen bestimmten Zeitraum und bedürfen einer Überprüfung und Adaptierung. Der Zeitpunkt der Überprüfung orientiert sich an diesem zeitlichen Horizont.
Formale Gestaltung
Formal enthält der Individuelle Förderplan neben den persönlichen und anamnestischen Daten der Schülerin/des Schülers eine klare, übersichtliche und präzise (möglichst knappe) Darstellung
· der jeweiligen Lernausgangslage,
· der auf einen bestimmten zeitlichen Horizont bezogenen Förderziele und Fördermaßnahmen sowie Notizen zu Prozessbeobachtungen
· der Überprüfung der Lernprozesse und Zielerreichung sowie
· der Fortschreibung bzw. Adaptierung der Lernziele und Fördermaßnahmen
Einsichtnahme in den jeweiligen individuellen Förderplan
Einsicht in den Individuellen Förderplan ist zugewähren:
allen an der Förderplanarbeit beteiligten Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleiterin/dem Schulleiter, der Schulaufsicht auf Bezirksund Landesebene,
den Erziehungsberechtigten und den betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie –
mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten – weiteren schulischen oder außerschulischen Expertinnen und Experten oder Maßnahmenträgern.
Elternbeteiligung
Im Sinne eines partizipativen Bildungskonzeptes sind nach Maßgabe der Möglichkeiten auch die Erziehungsberechtigten sowie die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler in den Prozess der Förderplanung einzubeziehen.
Kosten für dislozierten Unterricht
Als Elternvertretung haben wir über Jahre hinweg beharrlich die Erläuterung durch das Unterrichhtsministerium an die Schulen und Schulerhalter eingefordert, dass und in welchem Umfang der Grundsatz der Schulgeldfreiheit anzuwenden ist. Besonders schwierig war es, eine klare Feststellung zu erhalten, dass die Fahrtkosten zum dislozierten Unterrichtsort und zurück nicht von den Eltern sondern vom Schulerhalter zu tragen sind.
"Stehen einer Schule an ihrem Standort jedoch die zur Durchführung des Lehrplanes erforderlichen Räume oder Einrichtungen nicht oder nicht im ausreichenden Ausmaß zur Verfügung, so ist sie verpflichtet, auf Kosten des Schulerhalters, der nach dem Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz auch für die entsprechende räumliche Ausstattung der Schule Sorge zu tragen hat, für entsprechende „Ausweichquartiere" zu sorgen; so zum Beispiel durch den Besuch eines Schwimmbades. Ebenso wie die Kosten für den Eintritt in ein Schwimmbad im Rahmen des Unterrichtes sind auch erforderliche Transportkosten zum Schwimmbad vom Schulerhalter zu tragen."
Seit das Bildungsministerium sich unmissverständlich dazu geäußert hat, dass dislozierter Unterricht für die Eltern nicht nur keine Kosten für den Eintritt sondern auch keine Kosten für die Fahrt zum Unterrichtsort aufwerfen darf, haben einige Bildungsdirektionen dazu erläuternde Rundschreiben verfasst, um für ihren Aufsichtsbereich noch mehr Klarheit zu schaffen.
Werden auch noch andere Personen, wie beispielsweise SchwimmtrainerInnen, tätig >> Einbeziehung externer Experten in den Unterricht
Erläuterungen einiger Bildungsdirektionen nachstehend jeweils auszugsweise:
Information über die Kostentragung des dislozierten Schwimmunterrichts
Aufgrund einer Klarstellung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung darf auf die nachstehenden Informationen hingewiesen und um künftige Beachtung ersucht werden:
Die grundlegende Fähigkeit des Schwimmens ist eine lebenserhaltende Fähigkeit und auch über die Schulzeit hinaus unerlässlich, weswegen Schwimmunterricht auch in den Lehrplänen aller Schulstufen entsprechend verankert ist.
Die burgenländischen Schulen werden ausdrücklich angehalten, kontinuierlich an den Schwimmkompetenzen der SchülerInnen zu arbeiten und ausreichend Unterrichtsstunden dafür einzuplanen.
Im Zusammenhang mit der Organisation von Schwimmunterricht stellen sich immer wieder eine Reihe organisatorischer Fragen, die mit den folgenden Ausführungen näher erläutert werden sollen:
Schwimmen ist als Teil des Pflichtgegenstands Bewegung und Sport im Lehrplan verankert. Schwimmeinheiten sind deshalb grundsätzlich reguläre Unterrichtseinheiten und können somit weder als Schulveranstaltung noch als schulbezogene Veranstaltung organisiert werden.
Die Festlegung der für die Erreichung des Unterrichtsziels notwendigen Anzahl an Schwimmeinheiten obliegt der unterrichtenden Lehrperson.
Sollen im Rahmen des lehrplanmäßig vorgesehenen Schwimmunterrichts neben den jeweiligen Lehrkräften auch noch andere Personen, wie beispielsweise SchwimmtrainerInnen, tätig werden, so ist dies als sogenannte „Einbeziehung externer Experten in den Unterricht“ zu qualifizieren. Dabei ist zu betonen, dass den Lehrkräften nach wie vor die Unterrichtsarbeit samt Vor- und Nachbereitung der Stunde obliegt und die Unterrichtserteilung nicht zur Gänze an die externen Experten delegiert werden kann. Etwaige dadurch entstehende Kosten sind nicht vom Schulerhalter zu tragen.
Grundsätzlich unterliegt die Erteilung von Unterricht der Schulgeldfreiheit und es dürfen den Erziehungsberechtigten keine Kosten vorgeschrieben werden. Davon kann auch durch schulpartnerschaftliche Beschlüsse nicht abgegangen werden. Freiwillige Beiträge, um beispielsweise externe Expert/innen in den Unterricht einzubeziehen, sind aber möglich.
.....
Aktivitäten im BESP-Unterricht - Schulgeldfreiheit
Eintritt- und Fahrtkosten für alle Aktivitäten, die während des lehrplanmäßigen BESPUnterrichts (auch in geblockter Form) abgedeckt und nicht als Schulveranstaltung (lt. SchVV 1995) bzw. als schulbezogene Veranstaltung angeboten werden, sind von der Schule zu tragen.
Dazu zählen auch Eintritte für Kletterhallen, Eislaufplätze und anderbe Sport- und Freizeitstätten. Die Kosten dafür dürfen nicht von den Eltern eingehoben werden. Ausgenommen davon sind Gebühren für Materialien (u.a. Ausrüstung wie z.B. Leihgebühr für Eislaufschuhe).
Lehrplanmäßiges Schwimmen - Schulgeldfreiheit
...Kosten für den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht zur Gänze von der Schule zu tragen. Sie dürfen nicht an Eltern weiterverrechnet werden (Schulgeldfreiheit).
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Eintritte und Fahrtkosten für alle Aktivitäten, die während des lehrplanmäßigen BESP-Unterrichts (auch in geblockter Form) abgedeckt und nicht als Schulveranstaltung (lt. SchVV 1995) bzw. als schulbezogene Veranstaltung angeboten werden, von der Schule zu tragen sind. Dazu zählen auch Eintritte für Kletterhallen, Eislaufplätze oder andere Sport- und Freizeitstätten. Die Kosten dafür dürfen nicht von den Eltern eingehoben werden. Ausgenommen davon sind Gebühren für Materialien (u.a. Ausrüstung, wie z.B. Leihgebühr für Eislaufschuhe).
Schwimmen ist als Teil des Pflichtgegenstands Bewegung und Sport im Lehrplan verankert. Schwimmeinheiten sind deshalb grundsätzlich reguläre Unterrichtseinheiten
Weiterlesen: Schwimmen ein umsetzungspflichtiger Bestandteil des Bewegungsunterrichts
Oktober 2023: Start des Bildungs- und Berufsorientierungstools „Deine Zukunft" - hier
Die Zugangsdaten zum BBO-Tool erhalten die Schulen von der Bildungsdirektion.
Da die Arbeits- und Berufswelt heute mehr denn je durch dynamische Umbrüche gekennzeichnet ist, neue Berufe und Berufsfelder entstehen, andere an Bedeutung verlieren, brauchen Schülerinnen und Schüler verstärkt Orientierungshilfe sowie Begleitung bei Bildungswegentscheidungen und bei der Berufswahl.
Das BBO-Tool „Deine Zukunft“ ist ein wissenschaftlich fundierter Online-Fragebogen, der zu Beginn der 7. Schulstufe zum Einsatz kommt und Schüler/innen bei ihren ersten Überlegungen zu Fragen der Schul- und Ausbildungsentscheidung unterstützt.
Der Fragebogen besteht aus drei Teilen, die sich auf
Laufbahngestaltungskompetenzen,
ausgewählte Aspekte für Schulerfolg und
Fächerinteressen beziehen.
Die Fragen wurden mit Expertinnen und Experten entwickelt und stammen in Auszügen von bewährten Instrumenten wie dem Wegweiser (18plus Programm), dem Fächerinteressenstest und dem Stop-Dropout-Fragebogen, der teilweise im Jugendcoaching Verwendung findet.
Die Bearbeitung des Fragebogens durch die Schülerin bzw. den Schüler erfolgt in der Schule und dauert circa 15 Minuten
Schülerinnen und Schüler (und ihre Erziehungsberechtigten) erhalten anschließend an die Durchführung eine individuelle Ergebnisdatei samt Ergebniscode und konkrete Handlungsvorschläge für empfehlenswerte nächste Schritte,
Die Schule erhält aggregierte (zusammengeführten) Klassenergebnisse, die zeigen, wie weit Laufbahngestaltungskompetenzen bereits ausgebildet sind und wo die Hauptinteressen der Schüler/innen liegen. Dies liefert Ansatzpunkte für die Gestaltung eines zielgerichteten BBO-Unterrichts.
Der AMS-Ausbildungskompass >> hier
Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen einen einmaligen Überblick zum österreichischen Bildungssystem und informiert zu über 3.500 Ausbildungen und zu über 1.100 Ausbildungseinrichtungen. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Universitäten in Österreich.
Detaillierte Beschreibungen zu den Ausbildungen zeigen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen und welche Bildungseinrichtungen die Ausbildungen anbieten, sowie die Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten nach Abschluss. Der Ausbildungskompass bietet eine einzigartige Verknüpfung zwischen Ausbildungen und Berufen – und informiert über passende Ausbildungen zum gewünschten Beruf.
Der Fokus liegt dabei auf Ausbildungen, die zu einem formal anerkannten Abschluss (Schulabschluss, Matura, Akademischer Grad, etc.) führen oder zur Tätigkeitsausübung eines anerkannten Berufes berechtigen.
Zu den einzelnen Ausbildungen finden Sie auch die Adressen der Institutionen, die diese Ausbildung anbieten (erst nach erfüllter Schulpflicht, also z. B. keine Volksschulen).
Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf.
Der Ausbildungsassistent berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf.
Das Webportal ist ein Service der Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation – kurz ABI. Zu den Aufgaben der Abteilung gehört die Erstellung von Informationsmaterialien (Folder, Broschüren,...), die Entwicklung, Bereitstellung und Aktualisierung von Online-Instrumenten zur Unterstützung bei der Suche nach Ausbildung, Beruf und Trends am Arbeitsmarkt.
siehe auch: Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation des AMS Österreich > Zahlen ,Daten, Fakten
Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at
Berufsfindungsbegleitung
Seit mehr als 20 Jahren fungiert die STVG im Rahmen der Berufsfindungsbegleitung als Zentrum zur Vernetzung von Schüler/innen, Pädagog/innen und Unternehmen. Ziel ist es den Jugendlichen eine Orientierungshilfe anzubieten, um leichter ihren Platz in der regionalen Wirtschaft zu finden.
>>> hier
Verantwortung der Schule und geltende Regeln bei der "Einbeziehung externer Experten in den Unterricht“:
Auf Weisung* des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ergingen folgende Feststellungen:
"Es wird bekräftigend auf die Reichweite des § 17 des Schulunterrichtsgesetzes hingewiesen, in dem die Erfüllung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an den Schulen gesetzlich den Lehrkräften in eigenständiger und verantwortlicher Konkretisierung übertragen ist. Den einzelnen Lehrkräften steht es im Rahmen ihrer eigenständigen und eigenverantwortlichen Gestaltung des Unterrichts frei, außerschulische Personen in den Unterricht einzubinden,
insbesondere unter Gewährleistung der Einhaltung der Regelungen betreffend die Erteilung des lehrplanmäßigen Unterrichts und der Schulgeldfreiheit. Die den Lehrkräften zukommende besondere Verantwortung gebietet im Sinne einer sachgerechten Aufgabenerfüllung bei ihren Tätigkeiten, unter anderem Lehrpläne, Erlässe und die Aufgaben der österreichischen Schule gemäß § 2 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes umzusetzen, und von Handlungen oder Vorgangsweisen Abstand zu nehmen, die diese Ziele und Vorgaben gefährden oder in Frage stellen."
"Nach § 56 Schulunterrichtsgesetz ist die Schulleiterin bzw. der Schulleiter für die Qualitätssicherung am Schulstandort verantwortlich. Daher ist bereits im Vorfeld mit den außerschulischen Expertinnen und Experten der Einsatz im Unterricht, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch, abzustimmen. Lehrpersonen müssen sich von den fachlichen Kompetenzen und den Absichten der außerschulischen Expertinnen und Experten zuvor ein Bild machen.
Den Lehrkräften und den Schulleitungen kommt somit eine besondere Verantwortung in der Zulassung externer Referentinnen und Referenten zu."
* Diese Weisung wurde anlässlich der Beschwerden betreffend der (unkontrollierten) Abhaltung von Workshops zur Sexualpädagogik vom BMBWF erlassen. Es wird klargestellt, was beim Einsatz jeglicher externer Personen, unabhängig vom Thema, zu beachten/einzuhalten ist. Zur Weisung siehe unten.
In der oben angeführten Weisung des BMBWF wird festgehalten:
"Außerdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Lehrpersonen bei den im Betreff angeführten sowie allen anderen durch außerschulische Expert/innen abgehaltenen Workshops in ihrer Klasse anwesend zu sein haben und nicht ihrer Hauptaufgabe, der Unterrichts- und Erziehungsarbeit gemäß §17 Schulunterrichtsgesetz, entbunden sind."
Aus o.a. Weisung des BMBWF:
"Den einzelnen Lehrkräften steht es im Rahmen ihrer eigenständigen und eigenverantwortlichen Gestaltung des Unterrichts frei, außerschulische Personen in den Unterricht einzubinden,
insbesondere unter Gewährleistung der Einhaltung der Regelungen betreffend die Erteilung des lehrplanmäßigen Unterrichts und der Schulgeldfreiheit."
Schulgeldfreiheit im Verfassungsrang
Im österreichischen Schulrecht ist der Grundsatz der Schulgeldfreiheit verankert.
Gemäß § 5 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes (SchOG) ist nicht nur der Besuch der öffentlichen Pflichtschulen (siehe § 43 des Steiermärkischen Pflichtschulerhaltungsgesetzes 2004 bzw. § 28 des Steiermärkischen Berufsschulorganisationsgesetzes 1979), sondern auch der Besuch der sonstigen unter das Schulorganisationsgesetz fallenden öffentlichen Schulen unentgeltlich.
Artikel 14 Bundes-Verfassungsgesetz
(10) In den Angelegenheiten der Schulgeldfreiheit ... , können Bundesgesetze vom Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
zu beachten: die Bestimmungen bzw. Ausführungen betreffen die öffentlichen Schulen, nicht jedoch die Privatschulen.
Eine Abstimmung an der Schule über die in unserer Bundesverfassung verankerte Schulgeldfreiheit ist nicht vorgesehen.
Das Gesetz unterliegt keiner Willensbildung vor Ort sondern ist schlichtweg einfach anzuwenden.
Teilnahmepflicht
Gem. § 43 SchUG sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet den Unterricht zu besuchen.
ABER:
Findet ein externes Angeot als schulbezogene Veranstaltung statt, so gilt:
1. die Teilnahme nur bei Anmeldung
2. von der Schulgeldfreiheit ausgenommen
im Speziellen: Sexualpädagogik - Workshops
Der Markt mit Angeboten von Einzelpersonen und Vereinen, die in die Schulen wollen, ist riesig. Aktualisiert 10.Juli 2023
Das BMBWF wird * eine Geschäftsstelle zur Qualitätssicherung von schulexternen Angeboten zur Unterstützung des schulischen Unterrichts einrichten und wird dazu eine Verordnung erlassen: *Mit 1. März 2023 nimmt diese Geschäftsstelle ihre Arbeit auf. Pressemeldung vom 6. Juli 2023: Board nimmt im Schuljahr 2023/24 Tätigkeit auf- Mitglieder bestellt >> Mitglieder
die externe Qualitätssicherungsverordnung.
Kundgemacht-14.02.2023: externe Qualitätssicherungsverordnung >> RIS
Trotz der allgemein gehaltenen Formulierung "schulexternen Angeboten zur Unterstützung des schulischen Unterrichts", befasst sich die vorligende Verordnung (bis 1.Dezember 2022 in Begutachtung) - neben den Vorschriften über die Zusammensetzung und Arbeitsweisen - konkret nur mit Angeboten zum Themenfeld Sexualpädagogik
Dafür ist eine organisatorisch und personell getrennte,Geschäftsstelle zur Qualitätssicherung von schulexternen Angeboten zur Unterstützung des schulischen Unterrichts im Themenfeld „Sexualpädagogik“ (nachfolgend: Geschäftsstelle Sexualpädagogik) einzurichten.
Aufgaben der Geschäftsstelle Sexualpädagogik § 2
§ 2. Die Geschäftsstelle Sexualpädagogik hat
1. die Schulbehörden und Schulen bei der Beurteilung der fachlichen und didaktischen Qualitätm schulexterner Angebote durch webbasierte Bereitstellung von Unterlagen zur Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung zu unterstützen,
2. die dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung webbasiert zugehenden Meldungen schulexterner Angebote unter fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten zu
beobachten und die dabei übermittelten Informationen auszuwerten,
3. die Organisation von wissenschaftlichen Fachgutachten über schulexterne Angebote als externe fachliche Qualitätssicherung zur Unterstützung des schulischen Unterrichts durchzuführen, und
4. Feedbackmeldungen zum Einsatz schulexterner Angebote von am Schulleben beteiligten Personen zu beobachten, auszuwerten und dem Board zu übermitteln.
Beurteilungsmaßstab – Qualitätsziel - § 6
Schulexterne Angebote, einschließlich Unterrichtsmittel und Dienstleistungen zur Unterstützung des schulischen Unterrichts, im Themenfeld Sexualpädagogik haben
1. fachlich und didaktisch internationalen wissenschaftlichen Standards auf dem Gebiet zu entsprechen,
2. den für diesen Themenbereich relevanten Grundsatzerlässen und Lehrplänen zu entsprechen,
3. die Grundrechte von Schülerinnen und Schülern sowie das elterliche Erziehungsrecht zu achten
und
4. dem für staatlichen schulischen Unterricht grundrechtlich normierten Neutralitätsgebot, Pluralitätsgebot, Diskriminierungsverbot, Indoktrinationsverbot und Herabsetzungsverbot zu entsprechen.
Die Geschäftsstelle stellt dann über eine Plattform Ergebnisse ihrer Beurteilung der einzelnen Angebote den Schulen und Eltern zur Verfügung.
Elternrechte
Da – wie im Grundsatzerlass Sexualpädagogik geregelt – den Eltern und Erziehungsberechtigten im Bereich der sexuellen Bildung eine zentrale Aufgabe zukommt, sind die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten rechtzeitig im Vorfeld über die Einbindung von außerschulischen Personen und Organisationen z.B. im Rahmen eines Elternabends über Folgendes zu informieren:
Name der Person/Organisation und deren wertebezogenen Hintergrund
Geplante Inhalte und Methoden
Verwendete Materialen sollten den Eltern vorgestellt bzw. zur Verfügung gestellt werden.
Siehe auch RS 5/2019 außer Kraft NEU: RS 2/2025
Schulgeldfreiheit - was heißt das?
Schulgeldfreiheit im Verfassungsrang
Unterrichtsprinzip Sexualpädagogik
Unterrichtsprinzip Gleichstellung von Männern und Frauen
Sexualerziehung - ein Unterrichtsprinzip
Sexualpädagogische Workshops- außerschulische Organisationen
sexualpädagogische Workshops - Meldepflicht der Schulen
Einsatz schulexterner Expertinnen und Experten
Berufe entdecken, die zu den Talenten passen
Um herauszufinden, welche Berufe zu den eigenen Potentialen passen wird das Talente-, Kompetenz- und Fähigkeiten-Profil mit den Anforderungen von mehr als 2500 Berufen abgeglichen. Jene Berufe, mit denen sich die Talente, Kompetenzen und Fähigkeiten am meisten decken, werden dann im Menüpunkt "Passende Berufe" angezeigt.
Hier noch kurz zusammengefasst jene Module, die für Schülerinnen und Schüler interessant sein könnten:
Talent-Ermittlungsmodul: ermittelt mit Hilfe der „künstlichen Intelligenz" die veranlagten Talente, Potenziale, Fähigkeiten und Kompetenzen.
Schul- und Lehrberufsvorschlags-Modul: schlägt geeignete weiterführende Schulen und/oder geeignete Lehrberufe auf Basis der veranlagten Talente und Potenziale vor.
Darüber hinaus enthält die Plattform eine Reihe weiterer Module, die zu einem späteren Zeitpunkt für die Schülerinnen und Schüler relevant werden könnten, und ebenfalls dauerhaft kostenlos zur Verfügung gestellt werden:
Berufsmatching-Modul: gleicht die ermittelten Kompetenzen und Talente mit 2500 Berufsprofilen ab.
Berufsvorschlags-Modul: schlägt geeignete Berufe auf Basis der veranlagten Talente und Kompetenzen vor.
Passgenaue Jobangebote: gemäß der veranlagten Potenziale, Talente und Kompetenzen.
All-In-Bewerbungsmappe: ermöglicht Bewerbungen mit 1 Klick.
Karriereplanungsmodul: ermöglicht es die Karriere vorausschauend zu planen.
Karrierebegleitmodul: unterbreitet passende Jobvorschläge für den nächsten Karriereschritt.
Alle Infos unter: www.talents4jobs.com
# Nachteilsausgleich in Österreich: Gesetzliche Grundlagen
"Nach Art. 6 BVG Kinderrechte hat jedes Kind mit Behinderung Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen. Zudem ist die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Kindern im Sinne des Art. 7 Abs. 1 B-VG in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. Demnach sind die Gebietskörperschaften verpflichtet, in Gesetzgebung oder Verwaltung die Diskriminierung von behinderten Kindern im täglichen Leben abzubauen" (vgl. Grabenwarter/Frank, B-VG Art. 6 BVG Kinderrechte Rz 2 [Stand 20.06.2020, rdb.at]) aus: VfGH_Erkenntnis_G_259_2023_vom_13._Maerz_2024.pdf Seite 5
Durch einen Nachteilsausgleich bekommen Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen durch gezielte Hilfestellungen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten nachzuweisen. Es geht darum, den Blick auf die individuellen Möglichkeiten, Prüfungen erfolgreich absolvieren zu können, zu richten. So wird eine Kompensation des mit einer Behinderung verbundenen Nachteils hergestellt.
Wurde eine Leistung mit Maßnahmen eines Nachteilsausgleichs erbracht, so stellt diese eine gleichwertige Leistung dar. Somit sind Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Behinderung eine entsprechende Leistung nicht erbringen können unter Bedachtnahme auf den wegen der Behinderung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen.
Art und Umfang von Nachteilsausgleichen sind stets so auszurichten, dass die in der Behinderung begründete Benachteiligung ausgeglichen und dem Grundsatz der Chancengleichheit entsprochen wird. >> siehe>>  Nachteilsausgleich
Nachteilsausgleich
siehe auch: Ilse Schmid im Parlament
Angemessene Vorkehrungen für Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten
im Rahmen abschließender Prüfungen
Nachstehendes Rundschreiben wurde für abschließende Prüfungen zB bei der Matura/Reifeprüfung verfasst. Es fußt jedoch auf gesetzlichen Grundlagen, die nicht nur für derartige Prüfungen gelten und daher auf alle anderen Prüfungssituationen übertragbar sind:
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten mit Behinderungen, chronischen Krankheiten etc. RS 11/2021
Das Rundschreiben Nr. 11/2021 befasst sich konkret mit der Situation bei abschließenden Prüfungen.
Die grundsätzliche Bereitschaft für Kinder mit Behinderungen, chronischen Krankheiten, etc. Vorkehrungen zu treffen und so auch eine angemessene Leistungsfeststellung und -beurteilung zu ermöglichen, ist jeoch auch in andeeren Prüfungssituationen analog zu sehen.
Beispiele für mögliche Vorkehrungen am Prüfungsstandort
Ablaufplan/Checkliste für die Prüfungskandidatin/den Prüfungskandidaten erstellen und der Prüfung beilegen (z.B. bei Autismus-Spektrum-Störung)
eigener Raum
individuelle Pausen
individuelle Verlängerung der Arbeitszeit bzw. Präsentationszeit
Assistenz
Anwesenheit einer Person zur technischen Unterstützung bzw. für technischen Support beim Einsatz von Computern und anderen Geräten
Verwendung spezieller Ein- und Ausgabegeräte, Arbeit am Computer (z.B. Textverarbeitungsprogramm, elektronisches Wörterbuch, Software zur Sprachausgabe, Nutzung einer elektronischen Korrekturhilfe, Braillezeile, Eye-Tracking)
Hörverstehen: Pausieren/Unterbrechen der Audiodateien (auch selbstgesteuert), 1–2 zusätzliche Hörphasen
Im gerechtfertigten Bedarfsfall (z.B. Gehörlosigkeit) kann auf Ansuchen der Prüfungskandidatin/des Prüfungskandidaten der Prüfungsteil Hörverstehen entfallen.
Für Blinde und Sehbehinderte gibt es zusätzlich ein nach besonderen Kriterien aufbereitetes RTF und spezielle Grafikaufbereitungen.
Spezifische Empfehlungen bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS)
individuelle Verlängerung der Arbeitszeit
Arbeit am Computer: vorgesehen sind ein Textverarbeitungsprogramm,
die Nutzung einer elektronischen Korrekturhilfe und ein elektronisches Wörterbuch
Hörverstehen:
Pausieren/Unterbrechen der Audiodateien (auch selbstgesteuert)
1-2 zusätzliche Hörphasen
NEU Sep. 2025:
Regelung von ausgleichenden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen aufgrund von körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen sowie Sinnesbeeinträchtigungen >> hier
iBP und PAB
Rechtsgrundlagen:
a) Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG):
Allgemeines Diskriminierungsverbot: Art. 7, erster Satz B-VG
Besonderes Diskriminierungsverbot: Art. 7, zweiter und dritter Satz B-VG
b) Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGStG)
Mit Blick auf § 8 Abs. 2 BGStG ist der Bund ganz grundsätzlich verpflichtet, geeignete und erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu seinen Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. Diese Verpflichtung gilt unter anderem auch für die von ihm erhaltenen Schulen und Pädagogischen Hochschulen.
c) das jeweilige Landesgesetz
Zu beachten ist, dass es sich bei diesen Assistenzleistungen um eine individuelle Betreuungsleistung für Kinder/Jugendliche/Studierende mit einer Form von Behinderung handelt und KEIN pädagogischer Auftrag damit verbunden ist
iBP
iBP - Individuelle Betreuungsperson "Schulassistenz" -
STEIERMARK:
seit 1.1.2024 gibt es eine Änderung von § 7 des Stmk. Behindertengesetzes >> siehe hier
NEU*: für Schulkinder kommt das Steiermärkisches Schulassistenzgesetz 2023 zur Anwendung. Der Antrag wird bei der Schule eingebracht, die Landesregierung entscheidet.
Schulassistenz (früher mehrere Bezeichnunge: Pflege- und Hilfspersonen, ...) erfolgt für: bedarfsgerechte Betreuung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit
- einem Bedarf nach medizinisch-pflegenden oder pflegerisch-helfenden Leistungen oder
- sonstigen Bedarfen (ausgenommen pädagogische Leistungen).
*seit 1.1.2024 für neue Anträge StSchAG 2023
•medizinisch-pflegenden oder pflegerisch-helfenden Leistungen
• Hilfestellung zur Aufrechterhaltung der Motivation und Lernfreude (u.a. Ermutigung zur aktiven Mitarbeit), Unterstützung beim Halten der Konzentration und Aufmerksamkeit (u.a. Hinweise zur Weiterarbeit, Aufmerksamkeitsfokussierung bzw. -lenkung)
• Unterstützung bei der schulischen Organisation (...) und Erweiterung der Selbstständigkeit
• Hilfestellungen für die Umsetzung der aufgetragenen Arbeiten (...)
• Hilfestellung zur adäquaten Kontaktaufnahme zu anderen Kindern bzw. Vermeidung von Konflikten (u.a. Hilfestellungen zur Konfliktlösung, „Sprachrohr“)
• emotionale Unterstützung und Ermöglichung einer Bezugs- und Vertrauensperson
• Begleitung bei Ausflügen, Schullandwoche, etc. zur Kostenübernahme siehe hier
Weitere Infos siehe >> hier
Leistungsbeschreibung Schulassistenz - Transparenzdatenbank Österreich >>> hier
Individuelle Betreuungsperson (iBP) in der Schule - BD-Stmk>>> XIISchu1/0834-BD-STMK/2021
PAB
PAB-persönliche Assistenz in Bildungseinrichtungen - Regelungen für Bundesschulen, ...
Das BMB derzeit: BMBWF hat für SchülerInnen mit körperlicher Behinderung, die über die Eignung zum Besuch einer allgemeinbildenden höheren Schule oder berufsbildenden mittleren oder höheren Schule verfügen, 2013 das Projekt „Persönliche Assistenz in Bildngseinrichtungen“ (PAB) gestartet.
Persönliche Assistenz für körperbehinderte Schüler und Schülerinnen in Bildungseinrichtungen des Bundes, Änderung und Wiederverlautbarung RS 22/2021 außer Kraft und ersetzt durch
Erlass betr. Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung in Bildungseinrichtungen des Bundes Geschäftszahl: 2023-0.480.776
siehe auch EB-Dez.2022
Richtlinien für den Umgang mit Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) im schulischen Kontext RS 24/2021
wichtige Punkte aus dem Rundschreiben:
Chancengerechtigkeit und Durchlässigkeit sind wichtige Zielsetzungen im österreichischen Schulsystem. Vorliegende Richtlinien geben die Möglichkeit, alle Schülerinnen und Schüler mit auffallenden Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten zu unterstützen.
Der Begriff Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten umfasst sowohl die Lese-/Rechtschreibschwäche als auch die Lese-/Rechtschreibstörung nach WHO-Definition ICD-10.
Möglichst frühzeitiges Fördern
Zentral für die Verbesserung der Situation von Schülerinnen und Schülern mit Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten ist die frühzeitige Identifikation der individuellen Problematik durch die Lehrkräfte. Im schulischen Kontext werden die Fördermaßnahmen nicht auf Kinder und Jugendliche mit klinisch-psychologischer Diagnose eingegrenzt, sondern alle Schülerinnen und Schüler mit Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten werden in entsprechende Fördermaßnahmen im Rahmen des Unterrichts eingebunden.
WICHTIG: Es ist Lehrpersonen und Schulleitungen nicht gestattet, primär Empfehlungen für ExpertInnen, die außerhalb des Schulsystems agieren und daher von den Eltern zu bezahlen sind,
abzugeben. siehe Erlass der BD >> Einsatz schulexterner ExpertInnen >> link -
einen analogen Erlass gibt es auch für die mittleren und höheren Schulen >> link
BD Stmk: Handout LRS
Siehe Handreichungen
Deutsch und lebende Fremdsprache
Schülerinnen und Schüler mit Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten finden im Pflichtgegenstand Deutsch sowie in den lebenden Fremdsprachen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung eine Berücksichtigung (§ 3 Abs. 2 LBVO >> § 3 LBVO),
LRS als Form einer Körperbehinderung § 18 Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes
Bei nachweislich vorliegender umschriebener Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, die im Sinne des ICD-10 oder AWMF-S 3 das Erlernen und Anwenden der Rechtschreibung beeinträchtigten, ist § 18 Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes bzw. § 2 Abs. 4 und § 11 Abs. 8 LBVO anzuwenden. Bei dieser schwerwiegenden Form kann von einer Körperbehinderung im Sinne des Gesetzes gesprochen werden.
Ergänzende Richtlinien zum RS 24/2001 der BD Stmk vom Jänner 2022 >>> hier
LRS-Erlass der BD Stmk. vom März 2021 >>> GZ: IVBi1/0098-BD-STMK/2021
siehe auch EuLe-Veranstaltungen-Nachlese
Rahmenbedingungen bei Leistungsfeststellungen sollen entsprechend angepasst werden z.B.
Arbeit am Computer: vorgesehen sind ein Textverarbeitungsprogramm, die Nutzung einer elektronischen Korrekturhilfe und ein elektronisches Wörterbuch;
Hörverstehen: Pausieren/Unterbrechen der Audiodateien (auch selbstgesteuert), 1-2 zusätzliche Hörphasen
siehe auch: LBVO § 3 Absatz 2
(2) Die Einbeziehung praktischer und graphischer Arbeitsformen, zB die Arbeit am Computer oder projektorientierte Arbeit in mündliche und schriftliche Leistungsfeststellungen ist zulässig. Bei praktischen Leistungsfeststellungen ist die Einbeziehung mündlicher, schriftlicher, praktischer und graphischer Arbeitsformen zulässig.
Kein Einwand gegen zeitgemäße Hilfsmittel
Es besteht kein Einwand, dass Schüler/innen bei der Leistungserbringung - insbesondere auf höheren Schulstufen - bei schriftlichen Arbeiten zeitgemäße Hilfsmittel zur Überprüfung der Schreibrichtigkeit zur Verfügung gestellt werden. Davon werden Schüler/innen mit nachweislich legasthenischer Beeinträchtigung besonders profitieren.
 Dienstanweisung BMBF - Legasthenie, spezielle Bedürfnisse und neue Reifeprüfung
Dienstanweisung BMBF - Legasthenie, spezielle Bedürfnisse und neue Reifeprüfung
Bei der Leistungsfeststellung ist (bezüglich aller Schülerinnen und Schüler) auch zu beachten, dass in den Lehrplänen der Pflichtgegenstände Deutsch und der Lebenden Fremdsprachen mehrere Bereiche (eben nicht nur die Rechtschreibung) zu berücksichtigen sind: (siehe Rundschreiben Punkt 2.)
Leistungsbeurteilung
NEU Sep. 2025:
Regelung von ausgleichenden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen aufgrund von körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen sowie Sinnesbeeinträchtigungen >> hier
Die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes muss grundsätzlich erreicht werden.
Rechtschreibfehler, die auf einer Lese-/Rechtschreibstörung basieren, können bei der Leistungsbeurteilung im Unterrichtsgegenstand Deutsch bzw. in Fremdsprachen ganz oder teilweise unberücksichtigt bleiben.
Leistungsbeurteilungsverordnung zu beachten
Alle in § 3 LBVO angeführten Formen der Leistungsfeststellung (Mitarbeit, mündliche Leistungsfeststellungen, schriftliche Leistungsfeststellungen, praktische und graphische Leistungsfeststellungen) für Pflichtschulen sowie mittleren und höheren Schulen sind zu berücksichtigen und deren Einsatz ist als grundsätzlich gleichwertig anzusehen (Abs. 5).
Im § 16 der Verordnung über die Leistungsbeurteilung werden fachliche Aspekte für die Beurteilung von Schularbeiten angegeben. Für die Beurteilung in der Unterrichtssprache sind die fachlichen Aspekte Inhalt, Ausdruck, Sprach-richtigkeit und Schreibrichtigkeit angegeben. Sowohl aus den Lehrplanbe-stimmungen als auch aus der Verordnung ergibt sich somit eindeutig, dass der Gesichtspunkt der Schreibrichtigkeit keinesfalls die einzige Grundlage der Leistungsbeurteilung sein kann und darf.
Daraus ergibt sich,
dass schriftliche Leistungsfeststellungen nie für sich alleine die Grundlage einer Semester- bzw. Jahresbeurteilung sein dürfen (Abs. 3).
Lehrpläne zu beachten
Bei der Leistungsfeststellung ist zu berücksichtigen, dass im Lehrplan des Pflichtgegenstandes Deutsch folgende Bereiche angeführt sind:
Volksschule - Sprechen, Lesen, Verfassen von Texten, Rechtschreiben, Sprachbetrachtung; Hauptschule und AHS - Sprechen, Schreiben, Lesen und Textbetrachtung, Sprachbetrachtung und Sprachübung
Im Lehrplan der Mittelschule und AHS-Unterstufe wird in der Bildungs- und Lehraufgabe ausdrücklich betont, dass es sich um gleichwertige Lernbereiche handelt.
Schularbeiten und andere schriftliche Leistungsfeststellungen dürfen daher nicht ausschließlich nach Art und Anzahl der Rechtschreibfehler beurteilt werden.
zu Lehrplänen >>> hier
Schulunterrichtsgesetz hat "Sonderbestimmung"
Bei nachweislich vorliegender umschriebener Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, die im Sinne des ICD-10 oder AWMF-S 3 das Erlernen und Anwenden der Rechtschreibung beeinträchtigten, ist § 18 Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes bzw. § 2 Abs. 4 und § 11 Abs. 8 LBVO anzuwenden. Bei dieser schwerwiegenden Form kann von einer Körperbehinderung im Sinne des Gesetzes gesprochen werden.
SchUG § 18 Abs. 6 und Leistungsbeurteilungsverordnung >>> LBVO
Danach sind diese Schüler/innen unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen Behinderung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, wobei die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht werden muss. Mit Bezug auf die Leistungsbeurteilung - insbesondere im Pflichtgegenstand Deutsch - ist daher verantwortungsbewusst abzuwägen, inwieweit nur ein einzelner Leistungsbereich - nämlich die Schreibrichtigkeit - bestimmend für die gesamte Bildungs- und Berufslaufbahn eines jungen Menschen sein soll.
Mobbing
eine Subkategorie von aggressivem Verhalten
Nicht alles, was "landläufig" als Mobbing bezeichnet wird, fällt tatsächlich in die Kategorie Mobbing.
Mobbing ist gekennzeichnet von gezielt herbeigeführten Konflikten, die wiederholt bzw. reggelmäßig auftreten, gegenüber bewusst ausgewählten Opfern. Es gibt meist auch kein Bedauern und keine emotionale Betreoffenheit auf Seiten des Angreifenden.
Siehe auch: Mobbing im Klassenzimmer
>> Fachstelle Mobbing der KiJA
siehe auch EB Sep. 2017
Mobbingprävention in der Schule.
FH - Prof. PD Mag. Dr. Dagmar Strohmeier Fachhochschule Oberösterreich Online Vortrag , 7. Juni 2022  PPP-Folien
PPP-Folien
Handreichungen zum Thema:
 Leitfaden zur Mobbingprävention des BMB (Stand 04/2025) (PDF, 177 KB)
Leitfaden zur Mobbingprävention des BMB (Stand 04/2025) (PDF, 177 KB)
 Mobbing - Leitfaden zur Prävention - BMBWF 2019
Mobbing - Leitfaden zur Prävention - BMBWF 2019
 Mobbing an Schulen - Leitfaden für die Schulgemeinschaft BMBWF Oktober 2018
Mobbing an Schulen - Leitfaden für die Schulgemeinschaft BMBWF Oktober 2018
 Mobbingprävention im Lebensraum Schule bmbwf - oezeps 2018
Mobbingprävention im Lebensraum Schule bmbwf - oezeps 2018
Elternratgeber (Cyber-)Mobbing 1. Ausgabe Juni 2021 Stand Jänner 2021
Infoseite des BMBWF >> hier
Von: Pitzer Barbara [mailto:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!]
Gesendet: Dienstag, 28. Dezember 2021 11:00
An: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!'">'Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!' <Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!;
Cc: Jonach Michaela <Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.at>';
document.getElementById('cloak40883').innerHTML += ''+addy_text40883+'<\/a>';
//-->
;; Thaller Andreas <Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.at>';
document.getElementById('cloak12834').innerHTML += ''+addy_text12834+'<\/a>';
//-->
;
Betreff: Elternbrief Dezember 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich für die Zusendung des Elternbriefs vom Dezember 2021, in dem Sie auch ausführlich über das Qualitätsmanagementsystem für Schulen berichten.
Mir ist wichtig darauf hinzuweisen, dass, bezogen auf Ihre Frage, ob Schulpartnerschaft nicht gefragt ist, diese für die Qualitätsarbeit an Schulen eine wesentliche Bedingung ist. Gerade deswegen ist im Qualitätsrahmen für Schulen auch eine eigene Dimension „Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen“ zu finden.
QMS ist ein Werkzeug für die Schulen, um systematische und zielgerichtete Schul-und Unterrichtsentwicklung zu betreiben. Im QMS-Modell wird dargestellt, welche Gruppen von Akteurinnen und Akteure der Schule angesprochen sind und welche Werkzeuge für die qualitätsvolle Arbeit an Schulen zur Verfügung stehen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass sich Schulen mit diesem neuen Qualitätsmanagementsystem intensiv auseinandersetzen und die entsprechenden Werkzeuge und Tools kennenlernen und in der täglichen Arbeit umsetzen. Daher wurde im Erlass zum QMS auf die verbindliche Auseinandersetzung mit dem QMS am Schulstandort hingewiesen.
Keinesfalls geht es hier um Ausgrenzung von Schulpartnerschaft, sondern es geht darum, dass sich in erster Linie die Schulleitung und die Pädagoginnen mit dem QMS beschäftigen. Ziel einer Schule ist es, sich an den Kriterien des Qualitätsrahmens für Schulen zu orientieren, um in allen Dimensionen eine gute Schule zu sein und dazu gehört auch eine konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit mit allen Schulpartner/inne/n.
Alle Informationen zum QMS stehen unter www.qms.at zur Verfügung. Für weitere Fragen können Sie mich jederzeit kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Pitzer
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Sektion III - Bildungsentwicklung und Bildungsmonitoring
Abteilung III/5 - Qualitätsentwicklung und -sicherung
Dipl.Pädin. Barbara Pitzer, M.Ed.
Abteilungsleiterin
+43 1 53120-4706
Rosengasse 2-6, 1010 Wien, Österreich
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
bmbwf.gv.at
www.qms.at
Anforderungen an EinsteigerInnen in die berufliche Bildung
DIE 10 WICHTIGSTEN SOFT SKILLS > Lehrlingsportal
Was erwarten Unternehmen?
Vieles was in der Schule gelernt wird bzw. gelernt werden sollte, ist wichtig für die Ausbildung und das spätere Berufsleben.
Welche Kompetenzen und Eigenschaften die Betriebe sich wünschen, hat die Industrie- und Handelskammer Stade zusammengefasst und ist durchaus von überregionaler Gültigkeit. Siehe hier
zurück weiter zu Ermittle deine Talente
Häuslicher Unterricht
NEU 2024: RS 1/2024 mit diversen Anhängen zu Reflexionsgespräch und Externistenprüfung
Information der BD Stmk. Erlass: Geschäftszahl: IVMi1/601-2021 vom 14.9.2021
Wenn Erziehungsberechtigte vor Beginn des aktuellen Schuljahres bei der Bildungsdirektion die Erfüllung der Schulpflicht durch häuslichen Unterricht angezeigt haben, sind die betroffenen Kinder nicht mehr Schülerinnen oder Schüler Ihrer Schule. Sie sind daher nicht in der SchülerInnenverwaltung zu
führen, dürfen nicht in der Schulpflichtmatrik aufscheinen, und erhalten (5./6. Schulstufe) kein elektronisches Endgerät aus der diesbezüglichen Initiative des Bundes.
Eine punktuelle Teilnahme am Unterricht, an unverbindlichen Übungen oder dergleichen ist nicht möglich. Es besteht zwar ein Anspruch auf Schulbücher, darüber hinaus ist aber kein Unterrichtsmaterial auszugeben. Wird die Anzeige des häuslichen Unterrichts während des Schuljahres zurückgezogen oder untersagt die Bildungsdirektion den häuslichen Unterricht per Bescheid, müssen die Kinder ihre Schulpflicht ab diesem Zeitpunkt wieder in der Schule erfüllen.
Eine Rückkehr in die bisherige Schule oder die Aufnahme an einer Wunschschule ist möglich, kann aber nur nach Maßgabe freier Plätze und im Ermessen der Schulleitung erfolgen.
Ein Rechtsanspruch besteht lediglich auf einen Schulplatz in der sprengelmäßig zugeordneten Pflichtschule (sollten das mehrere sein, entscheidet in letzter Konsequenz die Gemeinde, welche Schule das Kind aufnehmen muss).
Hinsichtlich der medial angekündigten freiwilligen Überprüfungen des Lernstandes zu Semesterende sowie der Neuerungen zur Externistenprüfung werden Sie zu gegebener Zeit ein eigenes Informationsschreiben erhalten.
Es besteht grundsätzlich freie Wahl der Prüfungsschule, allerdings kann die Auswahl auf von der Behörde vorgegebene Prüfungsschulen eingeschränkt werden – dies wird für die Externistenprüfungen im Frühsommer 2022 sehr wahrscheinlich der Fall sein.
Siehe auch: Fragen zum häuslichen Unterricht BD Stmk.
Die österreichische Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen des 8 Punkte-Plans für den digitalen Unterricht ab dem Schuljahr 2021/22 die 5. Schulstufen* mit digitalen Endgeräten auszustatten.